Monographien
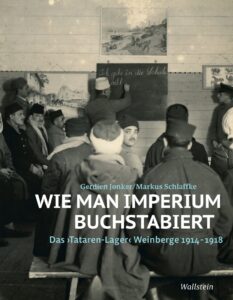
Wie man Imperium buchstabiert.
Das „Tartaren-Lager“ Weinberge 1914-1918
Gerdien Jonker, Markus Schlaffke (2025)
Am 19. November 1914 riefen Deutschland und die Türkei gemeinsam zum ›Jihad‹ gegen Russen, Briten und Franzosen auf. In Deutschland entstanden islamistische Propagandalager, in denen muslimische Kriegsgefangene für die deutsch-türkische Allianz im Ersten Weltkrieg gewonnen werden sollten.
Die 18.000 russisch-muslimischen Kriegsgefangenen im Weinberglager in der Nähe von Berlin bekamen diese Politik am eigenen Leib zu spüren. Ihre Bewacher versuchten sie mit einer ideologisch aufgeladenen ›islamischen‹ Propaganda zu ködern. Die Gefangene entwickelten indes Strukturen, um unter dem Radar der offiziellen Einflussnahme westliche Bildung zu erwerben. So buchstabierten sie ihre Rolle in der imperialen Ordnung und bereiteten sich auf ihren Kampf um Unabhängigkeit vor.
Gerdien Jonker und Markus Schlaffke haben sich auf Spurensuche begeben: In den Archiven, aber auch vor Ort, wo jahrzehntelang nichts mehr an das Lager erinnerte und heute allein ein Gräberfeld dessen Existenz dokumentiert. Die Grundspannung dieser besonderen Geschichte wird im Buch eingehend ausgeleuchtet. Jonker und Schlaffke zeigen, wie rassenhygienische Auslese, antikolonialer Befreiungskampf und die Krisenerfahrungen der Moderne im Lager aufeinanderprallten und wie die Kategorien der Identifikation sich verhedderten.
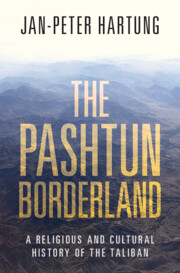
The Pashtun Borderland. A Religious and Cultural History of the Taliban
Jan-Pater Hartung (2024)
Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan im Jahr 2021 ist das Verständnis für die Geschichte und Ideologie der Gruppe noch dringlicher geworden. Jan-Peter Hartungs aktuelle Studie untersucht das Phänomen der Taliban durch das Prisma eines topografisch, ethnisch und geopolitisch einzigartigen Raums: das Paschtunische Grenzland des heutigen Afghanistan und Pakistan. Dabei betont Hartung die zentrale Rolle der paschtunischen Ethnizität und beleuchtet etwa fünfhundert Jahre paschtunischer Geschichte – von der frühneuzeitlichen Mogulzeit über das erste Durrani-Reich im 18. Jahrhundert bis hin zu den regionalen Entwicklungen während der Kolonialzeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Auf der Grundlage zahlreicher Primärquellen in Paschtu, Persisch, Urdu und Arabisch erweitert Hartung die Diskussion über die Taliban über die unmittelbare Berichterstattung und sicherheitsorientierte Studien hinaus. Er liefert eine differenzierte Analyse einer Vielzahl von Akteuren und Ideologien und betrachtet Afghanistans gegenwärtige Situation durch die Linse seiner langen kulturellen und religiösen Geschichte.
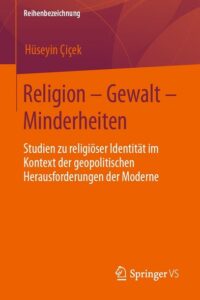
Religion – Gewalt – Minderheiten. Studien zu religiöser Identität im Kontext der geopolitischen Herausforderungen der Moderne
Hüseyin Çiçek (2023)
Der Band nimmt aus unterschiedlichen religionswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven aktuelle Themen der Religionswissenschaft in den Blick. Sie gehen explizit oder implizit von der zentralen religionswissenschaftlichen sowie -politischen These aus, dass Solidarität im Inneren von Gemeinschaften durch Feindschaft nach Außen begünstigt wird. Diese simpel wirkende Formel hat viele Facetten und wird deshalb in den jeweiligen Artikeln mit dem spezifischen Fokus auf Religion, Gewalt/Terrorismus und Minderheiten aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert, um sie sowohl komparativ als auch konnektiv auf den Prüfstand zu stellen.

Die deutsche Koranliteratur. Biographie und Bibliographie
Serdar Aslan (2022)
Über mehrere Jahre hinweg stellte Serdar Aslan eine umfangreiche Übersicht deutschsprachiger Koranliteratur zusammen, die eine hilfreiche Grundlage für Wissenschaft und Forschung aller Disziplinen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, darzustellen vermag. Aslan gibt einen informierten Überblick über die Rezeptions- und Forschungsgeschichte deutscher Koranliteratur und macht darüber hinaus auf eine Vielzahl bislang untererforschter Themen aufmerksam.
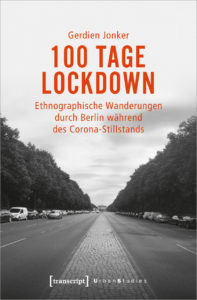
100 Tage Lockdown. Ethnographische Wanderungen durch Berlin während des Corona-Stillstands
Gerdien Jonker (2021)
18. März 2020 – der Tag, an dem Angela Merkel eine »Vollbremsung« der Gesellschaft forderte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. An diesem Tag begann Gerdien Jonker ihre Erkundungen durch Berlin: Ihre Beobachtungen erfassen eine Stadt, in der das öffentliche Leben nahezu völlig zum Erliegen gekommen ist. Hundert Tage lang war sie zu Fuß unterwegs, notierte Begegnungen mit Kindern, Joggerinnen und S-Bahnfahrern, besuchte Russen, Muslime und Chinesen, machte Skizzen vom Leben im Lockdown und von Berliner Erfindungsreichtum und Widerborstigkeit. Zwischen Forschung und Literatur entsteht so die Ethnographie einer Stadt im Ausnahmezustand.

„Lost in Transition“ – Analysen zur Aushandlung von Politik, Kultur und Identität im lokalen Raum von Tunis 2011 – 2014
Nina Nowar (2021)
Als junge Demokratie steht Tunesien als Hoffnungsträger und Erfolgsgeschichte im Mittelpunkt des Interesses der politikwissenschaftlichen Demokratieforschung. Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen Einblick in die politische Übergangsphase Tunesiens zu geben. Dabei steht anstatt der vorherrschenden wissenschaftlichen Perspektive auf nationalstaatliche Prozesse die Mikroebene politischer Aushandlungsprozesse im Mittelpunkt des Interesses. Zudem bricht die Studie mit normativen Erwartungshaltungen einer fortschreitenden Demokratisierung des Landes und distanziert sich von der perzipierten Pfadabhängigkeit der politikwissenschaftlichen Transitionsforschung. Jenseits dieses normativen Leitbilds wird die Vielfalt der politischen Entwicklungsalternativen erfasst, wie sie von den lokalen Akteuren in einem ausgewählten Stadtviertel von Tunis verhandelt wurde. Die Leitfrage lautet dabei nicht, wohin sich Tunesien aus westlicher Perspektive entwickeln sollte oder wie diese Transition vorankommt, sondern danach, was tatsächlich passiert (vgl. Carothers 2002, S. 18).

Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Eine quantitativ-empirische Analyse
Stephanie Müssig (2020)
In ihrer Dissertation, für die sie von der BAdW mit dem Preis der Peregrinus–Stiftung ausgezeichnet wurde, analysiert Stephanie Müssig Unterschiede in der politischen Partizipation zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland. Sie betrachtet entlang der religiösen, politischen und bildungsbezogenen Prägung im Herkunftsland sowie entlang der Aufenthaltsdauer, der politischen Rechte, der familialen Situation und der religiösen Partizipation im Zielland, wer politisch aktiv wird und wer nicht. Ihre Analysen zu Wahlbeteiligung, protestorientierter und parteinaher Partizipation zeigen, dass diese Faktoren vielfältige Folgen für die politische Gleichheit zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund haben.
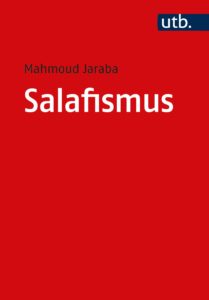
Salafismus
Mahmoud Jaraba (2020)
Nach einem Überblick über die historische Entwicklung, Definition und Charakteristika des islamistischen Extremismus zeichnet Jaraba die Etablierung des Salafisten-Netzwerkes in Bayern nach, das er 2016 und 2017 wissenschaftlich erforscht hat. Gezeigt wird, dass das radikale religiöse Narrativ, indem es Passagen aus den heiligen Texten des Islams (Koran und Sunna) missbraucht, sowohl Feindbilder innerhalb des Islams als auch Angriffe auf Christen und Juden generiert. Freilich ist es nicht Ziel des Buches, den Islam und Muslime zu verteufeln und sie allesamt des Terrorismus zu beschuldigen. Es gilt jedoch zu verstehen, in welcher Weise Salafisten ihre Ideologie mit religiöser Legitimität versehen, um nicht zuletzt da oder dort Präventions- oder Gegenmaßnahmen zu setzen.
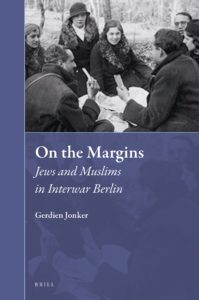
On the Margins – Jews and Muslims in Interwar Berlin
Gerdien Jonker (2020)
Jonker, die das Buch als Spinoff ihres vorherigen Werks, The Ahmadiyya Quest for Religious Progress bezeichnet, legt darin dar, wie die Juden und Muslime an den Rändern der deutschen Gesellschaft diese Position gemeinsam nutzten. Obwohl die Begegnungen meist zufällig waren, wurden sie durch die urbanen Lebensbedingungen im Westen Berlins begünstigt und die Politik der Weimarer Republik stellte entsprechende Weichen. In fünf Case Studies nähert sich die Religionswissenschaftlerin den Protagonisten und ihren Netzwerken aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum Vorschein kommen beispielsweise Geschichten von Muslimen, die Juden während der Verfolgung durch die Nazis zur Hilfe eilten. Mit bisher unerforschtem Archivmaterial zeichnet die Studie einen neues Bild von Juden und Muslimen im 20. Jahrhundert.
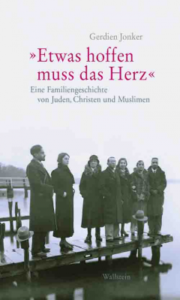
„Etwas hoffen muss das Herz“. Eine Familiengeschichte von Juden, Christen und Muslimen
Gerdien Jonker (2018)
Um 1900 begeisterten sich viele Deutsche für östliche Philosophien und Glaubensgemeinschaften. Auch die jüdisch-preußische Familie Oettinger fühlte sich von dieser religiösen Individualisierung angezogen. Gerdien Jonker erzählt die Geschichte der Oettingers anhand ihres staunenswerten Nachlasses – einer Sammlung von Erinnerungsstücken, Dokumenten und Fotos aus fast zwei Jahrhunderten, die von den Nachkommen bis heute wie in einem Schrein verwahrt wird. Die Autorin bringt diesen Nachlass zum Sprechen und entfaltet so eine ungewöhnliche Familiengeschichte über sieben Generationen zwischen deutsch-jüdischer Assimilation, einem kosmopolitischen Islam, dem Überleben im Nationalsozialismus und endlich dem Neuanfang im England der Nachkriegszeit.
Neben intensiven historischen Recherchen stützt sich die Autorin auf Rückblicke von Zeitzeugen und Gespräche mit den Nachkommen der Oettingers. Das Resultat ist ein neues und faszinierendes Kapitel europäischer Religionsgeschichte aus der intimen Sicht eines Familiengedächtnisses.
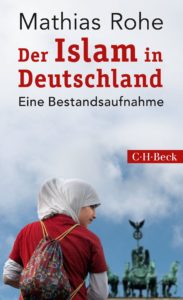
Der Islam in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme
Mathias Rohe (2016)
Seit Jahrzehnten leben Muslime in Deutschland, und doch werden sie von vielen als fremd, ja als Bedrohung empfunden. Mathias Rohe leistet mit seiner fundierten Bestandsaufnahme zum Islam in Deutschland einen Beitrag zur Versachlichung.
Das Buch beschreibt die Geschichte des Islams in Deutschland und die Vielfalt muslimischen Lebens in der Gegenwart. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich der Islam im deutschen Alltag entfalten kann: Welche Hürden gibt es für Moscheen,Minarette, Gebetsrufe oder religiöse Kleiderordnungen? Wie lassen sich die Ritualvorschriften – etwa Fasten, Beschneidung, Schächten – beachten? Sind islamische Normen mit deutschem Recht vereinbar? Abschließend fragt der Autor nach Perspektiven des Zusammenlebens in Zeiten von Flüchtlingen, muslimisch-religiösem Extremismus und Islamfeindlichkeit.
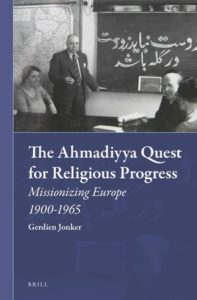
The Ahmadiyya Quest for Religious Progress. Missionizing Europe 1900 – 1965
Gerdien Jonker (2015)
Was passiert, wenn die Moderne durch die Idee religiösen Fortschritts vorangetrieben wird? In The Ahmadiyya Quest for Religious Progress. Missionizing Europe 1900 – 1965 beschäftigt sich Gerdien Jonker mit der Mission der Ahmadiyya Reformbewegung im Europa der Zwischenkriegsjahre. Sie zeigt auf, wie die Ahmadis, heutzutage in der muslimischen Welt oft Opfer von Verfolgungen, einen modernen, rationalen Islam vorangetrieben haben, der auch von nicht-islamischer Seite mit Interesse bedacht wurde.
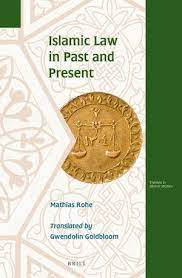
Islamic Law in Past and Present
Mathias Rohe, Übersetzung durch Gwendolyn Goldbloom (2014)
Das islamische Recht ist im Westen durch spektakuläre Todesurteile und drakonische Körperstrafen in Verruf geraten, ansonsten aber weitgehend unbekannt. Was ist die Scharia? Was ist eine Fatwa? Kann es im Islam eine Gleichberechtigung der Geschlechter geben? Diese und andere Fragen behandelt Mathias Rohe in der ersten umfassenden Darstellung des islamischen Rechts seit Jahrzehnten. Er beschreibt die Entstehung, Entwicklung und gegenwärtige Ausformung des islamischen Rechts, erläutert islamische Rechtsfindungsmethoden und schildert die Grundzüge des Familien-, Völker-, Straf- und Wirtschaftsrechts. Dabei kommen auch grundlegende Unterschiede zwischen Sunniten, Schiiten und anderen Richtungen zur Sprache. Ein Ausblick auf Perspektiven des islamischen Rechts in einer globalisierten Welt beschließt dieses anschaulich geschriebene Standardwerk, das nun in englischer Übersetzung erschienen ist.
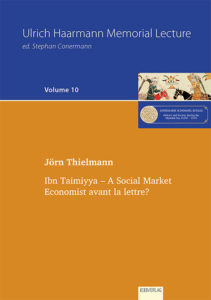
Ibn Taimiyya – A Social Market Economist avant la lettre?
Jörn Thielmann (2014)
Based on a reading of Ibn Taimiyya’s Al-Ḥisba fī l-Islām, Jörn Thielmann argues for some structural similarities between Ibn Taimiyya’s understanding of market economy and the ideas of some proponents of Germany’s social market economy, like Walter Eucken, Alfred Müller-Armack or Ludwig Erhard, which made their way into the German constitution, the Grundgesetz. Besides more conventional presentations of the moral nature of ḥisba, Ibn Taimiyya develops a short concept of human society based on reflections on the human nature by Aristotle in his Politeia. Here, he shares the same assumption as hundred years later Ibn Khaldūn. He also shows very deep insights into the functioning of markets and thus fills the so-called Schumpeterian gap that assumes that between antiquity and Thomas Aquinas nothing important has been written on economics. Thielmann demonstrates that this treaty is an original contribution to economic thought. These reflections emerge out of the particular historical circumstances of Ibn Taimiyya’s time: the Mongol threat and grain riots. Securing food supply in the big cities has been the main prerogative of the Mamluk rulers. To counter the Mongols, stability in society was needed.
This fresh look at a controversial figure of the Islamic history of thought provides proof of the complexity, richness and originality of his thinking beyond the usual stereotypes.
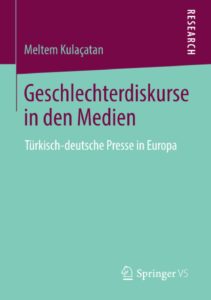
Geschlechterdiskurse in den Medien: Türkisch-deutsche Presse in Europa
Meltem Kulaçatan (2013)
Meltem Kulaçatan stellt das Geschlechterverhältnis in der medialen Öffentlichkeit in den Fokus, das sie auf der Grundlage des Pressediskurses der Europaausgaben der türkischen Tageszeitungen Hürriyet und Zaman untersucht. Basierend auf der deutschsprachigen Mehrheitsöffentlichkeit, der Öffentlichkeit in der Türkei und der türkischsprachigen Teilöffentlichkeit in Deutschland analysiert die Autorin die räumlichen und inhaltlichen diskursiven Verschränkungen anhand des Geschlechterdiskurses. Dabei lassen sich im Geschlechterverhältnis der türkischsprachigen Tageszeitungen Diskursverschränkungen feststellen, die eng mit der Politik in der Türkei verwoben sind. Gleichzeitig ist der Pressediskurs über die verhandelten Geschlechterbeziehungen sowohl mit dem Integrationsdiskurs als auch mit dem Politikdiskurs in Deutschland verschränkt, was sich in der Berichterstattung über Frauen aus dem türkischen und islamischen Kontext widerspiegelt.
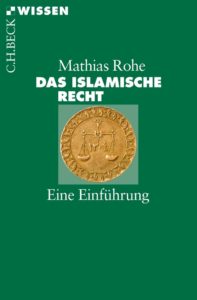
Das islamische Recht – Eine Einführung
Mathias Rohe (2013)
Die Scharia ist im Westen weithin zum Schreckensbegriff geworden. Für viele Muslime ist sie dagegen ein wesentlicher Teil ihres Selbstverständnisses. Mathias Rohe will mit seiner Einführung zur Versachlichung der Diskussion beitragen. Er zeigt, auf welche Quellen das Recht der Scharia zurückgeht, welches seine wesentlichen Inhalte sind und wie es sich gegenwärtig in der islamischen Welt, aber auch in Deutschland und Europa entwickelt.
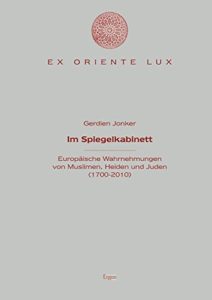
Im Spiegelkabinett. Europäische Wahrnehmungen von Muslimen, Heiden und Juden (1700-2010)
Gerdien Jonker (2013)
Nicht Sprache oder Physis, sondern der andere Glaube machte lange die christliche Differenzzuschreibung aus. Die vorliegende Studie beleuchtet aus historischer Perspektive und auf empirischer Basis, wie religiöse Alterität in deutschen Geschichtsbüchern konstruiert und immer weiter getragen wurde. Schulbücher repräsentieren den Kernbestand von Wissen, Weltbildern und Regeln, der gesellschaftlich an die nächste Generation weitergegeben werden soll. Sie enthalten auch wesentlich die Vorstellungen darüber, wie wir uns von anderen unterscheiden. Dabei wurde Alterität, die Definition des Gegenübers…
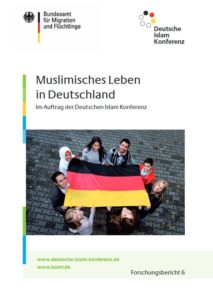
Muslimisches Leben in Deutschland. Im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz
Stephanie Müssig, Sonja Haug und Anja Stichs (2013)
„Mit der Studie ‚Muslimisches Leben in Deutschland‘ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge liegt die erste bundesweit repräsentative Datenbasis über Muslime vor. Sie gibt mit ca. 6.000 befragten Personen aus 49 muslimisch geprägten Herkunftsländern einen umfassenden Überblick über das muslimische Leben in Deutschland, insbesondere zu Anzahl der Muslime in Deutschland, Glaubensrichtungen, religiöse Praxis und verschiedenen Aspekten der Integration. Die Studie hat die Zielsetzung, Erkenntnisse über die muslimische Bevölkerung zu gewinnen, die ‚Normallagen‘ des Alltagslebens darzustellen und somit zur Versachlichung der Diskussion beizutragen. Zielgruppe der empirischen Erhebung sind in Deutschland lebende Muslime und Angehörige anderer Religionen, die aus 49 muslimisch geprägten Herkunftsländern stammen. Ca. 6.000 Migranten wurden bundesweit telefonisch befragt; dabei wurden auch Informationen über insgesamt 17.000 Haushaltsmitglieder erhoben.“
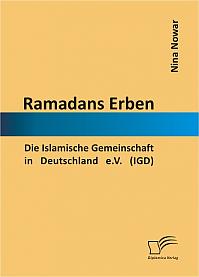
Ramadans Erben. Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD)
Nina Nowar (2012)
Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD) zählt zu den ältesten Organisationen des islamischen Feldes der Bundesrepublik. In den Jahren ihrer Blütezeit hat sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung dieses Feldes geleistet und bedeutende Fortschritte für die sunnitischen Muslime in der Bundesrepublik erzielt. Mit innovativen Projekten und viel Idealismus schuf sie eine Infrastruktur für die Glaubenspraxis und baute zu diesem Zweck ein deutschlandweites Netzwerk von angegliederten Islamischen Zentren auf. Ziel der Studie ist es, nachzuvollziehen, welche internen und externen Einflussfaktoren im islamischen Feld der 1990er Jahre den Bedeutungsverlust der IGD ausgelöst haben. Seit den 1990er Jahren hat die IGD ihre Machtposition im islamischen Feld verloren und führt nun ein Schattendasein. Ihre ehemalige Position wird heute von anderen Organisationen besetzt. Zur Auswertung wurde neben der Sekundärliteratur auch auf eigene Interviews zurückgegriffen, welche unter anderem mit einem hochrangigen Mitglied der Organisation, Wissenschaftlern und Experten geführt wurden. Zusätzlich wurden eigene Publikationen der IGD hinzugezogen, wie etwa die Zeitschrift ‚al-Islam’ und Veröffentlichung der Islamischen Zentrum Münchens e.V..
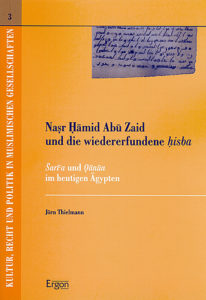
Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene ḥisba.
Jörn Thielmann (2003)